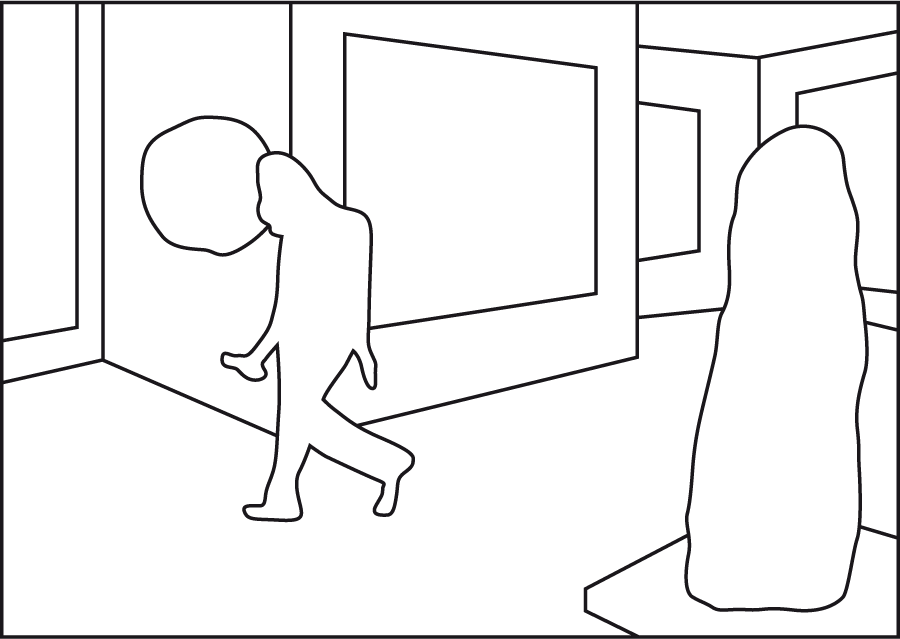Sechs Texte und ein Vorwort
Vorwort
Vanessa Joan Müller
Es gab einen Moment während der Lockdowns in der Corona-Pandemie, da hatten die Museen und Kunstinstitutionen geschlossen, die kommerziellen Galerien (die offiziell als Geschäfte gelten) waren hingegen geöffnet. Galerien wurden als Ausstellungsorte wahrgenommen, wo man fernab jeder Kaufabsicht Kunst betrachten kann. Tatsächlich gehört es zum Selbstverständnis der meisten Galerien, nicht allein marktorientiert zu handeln. Erst die Präsentation von Kunst jenseits des Verkaufsaspektes baut jenes symbolische Kapital auf, das die Wahrnehmung des Kunstwerks allein als Ware verhindert. Die Wertigkeit eines Kunstwerks bemisst sich schließlich nicht nur nach der ihr zugrunde liegenden künstlerischen Arbeit, sondern resultiert auch aus deren Rezeption. Symbolisch wertvoll wird ein Werk erst durch die kollektive Aufmerksamkeit, die sich auf es richtet, was sich dann in einem realen Preis spiegelt. Der Kunstmarkt ist also in hohem Maße auf ein Publikum angewiesen, das andere Interessen an der Kunst hat als die des Kaufens und Sammelns – auch, um den ökonomische Aspekt des Galeriewesens, seine kompetetive Struktur und die Machtansprüche seiner Player*innen zu überblenden.
Im Fokus der medialen Wahrnehmung stehen oft internationale Großgalerien, die Strategien von Wirtschaftskonzernen adaptieren, global expandieren, Verkaufszahlen evaluieren und scheinbar die Spielregeln vorgeben. Es gab und gibt jedoch auch Versuche, andere, alternative Modelle zu etablieren, die nach einem Gewinn streben, der sich nicht nur ökonomisch definiert. Abseits vom Streben nach Macht und Exklusivität gibt es durchaus Ideale, die eine Galerie zur Komplizin der Künstlerinnen machen und das komplexe System aus Sammlerinnen, Ausstellungshäusern, kuratorischen wie kommerziellen Interessen nicht als Gegebenheit sehen, sondern in seinen Abhängigkeiten betrachten und nach Alternativen oder zumindest Schwerpunktverschiebungen suchen.
Die Gewinn als gesellschaftlichen Gewinn definieren im Sinne von Inklusion statt Exklusivität und ästhetische Debatten über ökonomische Ambitionen stellen. Die Tätigkeit einer Galerie vereint scheinbar gegensätzliche Aspekte wie Einzelhandel und Kulturinstitution und bildet ein Scharnier zwischen Sammlerinnen, freier Kunstszene, Ausstellungswesen, Künstlerinnen und Kurator*innen. Diese Scharnierfunktion kann sie als Gatekeeper verstehen oder aber als moderierende Instanz.
Sebastian Jung zeigt in seinen Zeichnungen Momentaufnahmen einer Messe, also dort, wo sich das Kunstwerk am deutlichsten als Ware exponiert und die Galerie als unternehmerische Akteurin agiert. Der von dem Künstler als Teil seiner Kunst initiierte Think Tank versammelt Positionen, die dieses Bild zu kontrastieren versuchen. Künstler*innen produzieren Werke, die vermittelt und verkauft werden wollen. Galerien bieten die Infrastruktur und das Netzwerk dafür. Sie schaffen aber auch Kontexte und Kommunikation, streben nach Wahrnehmung für sich und die von ihnen präsentierte Kunst und reflektieren idealerweise ihre Position als eine der konstruktiven, auch konfliktuösen Ambivalenz immer wieder neu. Zugleich bleiben aber auch sie Teil eines übergreifenden Systems.